Heute wird es wissenschaftlich. Hochbegabte Schülerinnen und Schüler stehen in der Schule vor besonderen Herausforderungen. Dabei geht es nicht nur um die Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen, sondern auch um das System, in welchem sie aufwachsen. Heute beleuchte ich 5 ausgewählte Faktoren näher, die dazu beitragen. Dafür habe ich wissenschaftliche Hintergründe recherchiert. Diese Studien belegen, dass Hochbegabung zu Schulproblemen führen kann.
Fakt 1: Hochbegabung bei Schülern bleibt oft unerkannt
Stell dir vor, dein Kind ist hochbegabt, aber niemand weiß davon. Das ist erst einmal kein Problem, solange das Kind glücklich ist und gut durch die Schule kommt. Möglicherweise kommt es aber doch an einen Punkt, an dem es beginnt, zu stolpern. Lehrkräfte nehmen das Kind dann als still, überangepasst oder auffällig und laut wahr. Vermutet werden zunächst psychische Störungen, allen voran ADHS.
Junior-Prof. Jessika Golle hat sich diesem Thema in einer Studie der Forschungsgruppe Potenzialentwicklung und Hochbegabung in Tübingen angenommen. (Quelle) Sie sagt, dass Lehrkräfte oft ein subjektiv geprägtes Bild von Hochbegabung haben. Ich selbst schrieb in einem anderen Artikel, dass Neurodivergenzen, also auch Hochbegabung und Underachievement im Lehramtsstudium kaum thematisiert werden. Dazu trägt laut Jessika Golle bei, dass Lehrkräfte dazu befähigt werden sollen, ihre eigenen Einstellungen über das Thema Hochbegabung zu reflektieren und zu hinterfragen.
Ein ganzheitlicher Blick und das Hinterfragen eigener Glaubenssätze
Bewertet würden seitens der Lehrkräfte die kognitiven Fähigkeiten sowie die Schulmotivation und die Möglichkeiten aus dem Elternhaus. Für gewisse Förderangebote werden jedoch nur die Leistungsfähigkeit oder Interessen der Schüler herangezogen. Das würde das Feld der auszuwählenden Schüler enger machen, als Schüler mit großen Potenzialen vorhanden sind.
Daher sei es wichtig, sich einen umfassenden Überblick über die Potenziale der Schüler zu verschaffen. Beispielsweise im Austausch mit anderen Lehrkräften, aber auch mit dem Elternhaus. Durch herausfordernde Unterrichtsinhalte könnten die Potenziale der Schüler besser identifiziert werden.
Hochbegabung sei unterschiedlich konzeptioniert, sie zeigt auch kulturelle Unterschiede und Definitionen. Hochbegabte Mädchen fallen aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit weniger auf als hochbegabte Jungen. Eine hohe Begabung reiche aber nicht aus, um Höchstleistungen zu erbringen. Aus diesem Grund bleiben viele Hochbegabte unerkannt und unterliegen möglicherweise Fehldiagnosen.

Fakt 2: Hochbegabte Gehirne funktionieren anders
Werde ich gefragt, wie ich Hochbegabung definiere, sage ich zumeist: „Hochbegabung ist zunächst nur ein Potenzial, welches genutzt werden will. Aber diese Menschen denken anders und fühlen tiefer“. Das ist in der Studie „Neuroanatomical differences in the memory systems of intellectual giftedness and typical development“ wissenschaftlich belegt. (Quelle)
Physische Ebene von hochbegabten Gehirnen
Interessant ist, dass das Gehirn von Hochbegabten in Struktur und Funktion anders entwickelt ist als das Gehirn von Normalbegabten. Dies betrifft zunächst zwei physische Ebenen:
- Die Ebene der neuronalen Strukturen: größere subkortikale (unterhalb der Großhirnrinde) Strukturen und eine stärkere Vernetzung der mikrostrukturellen Organisation der weißen Substanz.
- Die Ebene der neuronalen Prozesse: z. B. bessere Koordination zwischen und innerhalb der Hirnregionen.
Auswirkungen von Hochbegabung
In die Praxis übersetzt hat dies folgende Auswirkungen für den hochbegabten Menschen:
- Auf kognitiv-funktionaler Ebene, also die Leistungsfähigkeit betreffend – und hier zitiere ich wörtlich aus der oben verlinkten Studie: „Komplexere und größere Wissensbestände können effizienter eingesetzt werden: bereichsübergreifende Verallgemeinerung, intuitive Wechsel der Aspekte, Selektion des Relevanten, Vergleiche großer Wissensmengen, Einsatz komplexer Strategien. Störbarkeit des Lernens bei nicht expliziten Lernaufgaben“.
- Auf Verhaltensebene: Die intrinsische Motivation ist stärker aktiviert sowie die Neigung, Zeit allein zu verbringen.
Ich finde die Erklärung der physischen Zusammenhänge aus dieser Studie sehr spannend. Sie gibt eine Erklärung dafür, warum hochbegabte Menschen nicht anders können. Warum sie tiefer und komplexer denken, lösungsorientierter sind und gut auf intrinsische Lernmotive ansprechen anstelle auf extrinsische Anreize. In meinem Artikel „Was ist Hochbegabung“ führe ich typische Symptome von Hochbegabung aus der Praxis auf, speziell in Bezug auf Kinder.

Fakt 3: Hochbegabte können unter einem schlechten Selbstwertgefühl leiden
Gerade schrieb ich davon, dass Hochbegabte dazu neigen, Zeit allein zu verbringen. Das kenne ich von mir selbst sehr gut, obwohl ich erst als erwachsene Frau als hochbegabt getestet wurde. Interessanterweise leide auch ich unter einem Syndrom, über welches die KARG-Stiftung berichtet: das Imposter-Phänomen (auch: Impostor-Syndrom). Doch nicht nur erwachsene Frauen leiden besonders darunter, sondern auch bereits Kinder und Jugendliche zeigen Tendenzen für dieses Selbstzweifel-Syndrom.
Die KARG-Stiftung bezieht sich in ihrem Artikel auf eine Studie von 1978 der Forscherinnen Pauline R. Clance und Suzanne A. Imes. Das Syndrom wurde in weiteren wissenschaftlichen Kontexten nachgewiesen. (Quelle) Wenngleich das Imposter-Phänomen nicht als psychische Störung gilt, so leiden die Betroffenen darunter. Vor allem ein schlechtes Selbstwertgefühl begleitet die Betroffenen. Sie können von Angststörungen, Depressionen oder anderen psychosomatischen Beschwerden flankiert werden.
Hochbegabte können sich durch Selbstzweifel selbst boykottieren
Die Betroffenen gehen dabei oft ein niedriges Risiko ein, was das Zeigen ihrer Potenziale angeht. Deshalb schreiben einige Schüler beispielsweise absichtlich schlechtere Noten, als ihr Potenzial es zuließe. Ein erreichter Erfolg macht sie selten glücklich, lieber wird der Erfolg äußeren Umständen zugeschrieben. Diese Selbstzweifel sorgen dafür, dass Hochbegabte sich selbst und ihre Leistungen infrage stellen.
Herausforderungen werden vermieden, was eine Verschlechterung der Leistungen in der Schule nach sich ziehen kann. Ein hoher Perfektionismus kann darüber hinaus zu hohen und kaum zu erfüllenden Selbstansprüchen führen. Aus diesem Grund kann eine Hochbegabung unerkannt bleiben, wie in Fakt 1 bereits erklärt. Diese Schüler werden zu Minderleistern und können in ein Underachievement rutschen.

Fakt 4: Hochbegabten Underachiever fehlen effektive Lernstrategien
Hochbegabte haben das Lernen nicht gelernt und scheitern deswegen in der Schule. Das ist eine steile These, die ich differenzieren möchte. Ich bin der Meinung, dass Hochbegabte sehr gut lernen können – wenn ihre intrinsische Motivation aktiv ist. Dann sind sie in der Lage, sich autodidaktisch alles Wissen anzueignen, was sie meinen zu benötigen und Transferleistungen schaffen. Das wird vor allem im Freizeitbereich deutlich, wo Hochbegabte ihren Neigungen nachgehen können.
Doch hier geht es um Lernstrategien in der Schule. Denn am schulischen Lernen können hochbegabte Schüler, die bereits ins Underachievement gerutscht sind, scheitern. Dazu habe ich eine Längsschnittstudie von Catharina Tibken und ihrem Team der Universität Würzburg gefunden. (Quelle) Sie schreibt, dass Hochbegabten das Lernen in der Grundschule noch sehr leichtfiele. Strategien waren unnötig, da das Wissen einfach vorhanden war. Es fiel ihnen sozusagen zu.
Das Fehlen von Lernstrategien erschwert die Selbstreflexion
Mit Eintritt in die weiterführende Schule würden sie jedoch dank des steigenden Anspruchs an die Lernaufgaben an ihre Grenzen stoßen. Das führe zu Frust, da Kinder spüren, dass sie ihr Potenzial nicht ausschöpfen können. Das wirke sich zunehmend negativ auf die Anstrengungsbereitschaft aus. Die Motivation sinkt, Lernstrategien anzuwenden.
Damit verbunden sei eine eingeschränkte Fähigkeit der Selbstanalyse. So konnten Underachiever schlecht einschätzen, ob sie einen Sachtext verstanden haben. Auch die Bereitschaft, dies überhaupt zu hinterfragen, sinke mit zunehmender Frustration. Positiv hervorzuheben ist, dass nun spezielle Trainings entwickelt werden sollen, um Lernstrategien und ihre Anwendung im Unterricht schon früh zu üben. Diese kommen wiederum allen Schülern zugute, nicht nur hochbegabten Underachiever.
Lies hier dazu auch meine 9 Tipps gegen ein Underachievement bei Hochbegabung in der Schule.
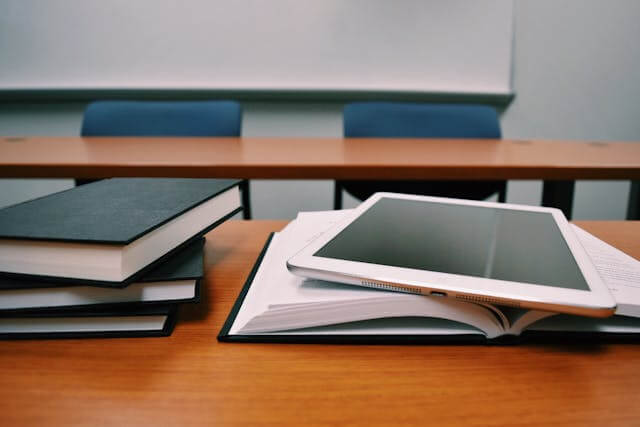
Fakt 5: Die Struktur des Schulsystems kann eine Entfaltung von Hochbegabung behindern
Während ich mich bis hierher nur der Eigenschaften und Fähigkeiten von Hochbegabten gewidmet habe, so möchte ich mit einem wichtigen Punkt abschließen. Denn die Umgebung, vor allem die Struktur des Schulsystems bzw. die Schulform kann eine Gefahrenquelle für die optimale Entfaltung von Potenzialen wie Hochbegabung sein.
In meinem Buch „Hochbegabt gescheitert – und neue Türen öffnen sich“ hebe ich die selbstregulierten und selbstgesteuerten Lernkonzepte positiv hervor. Ich finde, in diesen offenen und zugewandten Lernsystemen können Hochbegabte leichter ihren Neigungen nachgehen. Trotzdem sind Hochbegabte so unterschiedlich wie alle anderen Kinder auch. Es kommt auf die richtige Passung in der Schule an, ob Hochbegabte ihre Potenziale dort entfalten können.
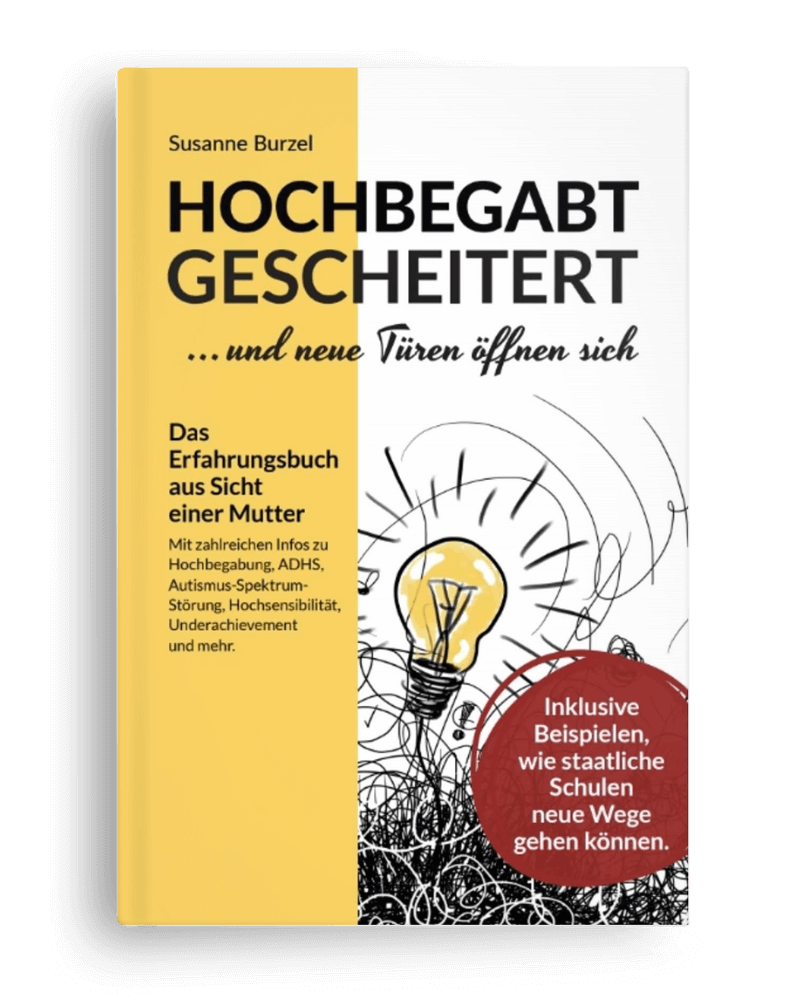
Zu unserer persönlichen Geschichte mit Hochbegabung, ADHS und vielen Diagnostiken habe ich ein Buch geschrieben: „Hochbegabt gescheitert - und neue Türen öffnen sich“.
Bei Amazon - oder im Buchhandel erhältlich: ISBN 978-3982620169
Die optimale Umgebung für das hochbegabte Kind ist eine individuelle Entscheidung
Diesem Thema hat Dipl.-Psych. Hella Schick ihre Dissertation gewidmet. Ihre Untersuchungsergebnisse zeigen, „dass der Frage nach der ,richtigen‘ Schulart weit weniger Bedeutung zukommt als der Frage nach einer gelungen Passung von Individuum und aktuell vorgefundener schulischer Umwelt“. (Quelle)
Ihrer Meinung nach ist eine Umgebung ideal, in der nachhaltiges Lernen, welches durch intrinsische Motivation erreicht wird, möglich ist. Ebenfalls ist ein hohes Interesse am Lerngegenstand wichtig sowie ein hoher Grad an Selbstbestimmung. Eine gesunde Entwicklung resultiere aus der Art der individuellen Passung, die das Schulkind mit der Schule habe. Das könne sich in unterschiedlichen Schulformen jeweils differenziert auswirken.

Diese Studien belegen, dass Hochbegabung zu Schulproblemen führen kann – mein Fazit
Dass Hochbegabung in der Schule zu Problemen führen kann, ist unumstritten. Welche Gründe dahinterstecken, ist interessant. Es gibt nie die eine Ursache, die dazu führt, dass hochbegabte Kinder in der Schule große Herausforderungen bewältigen müssen. Es ist zum einen in den Eigenschaften begründet, die eine Hochbegabung mitbringt. Neben den Besonderheiten der Ausprägung der Gehirnanatomie, welche die besonderen Eigenschaften von Hochbegabung auslösen, existieren weitere Faktoren.
Ein schlechtes Selbstwertgefühl, bedingt durch das Imposter-Syndrom oder ein hoher Perfektionismus kann dazu führen, dass Hochbegabung in der Schule unerkannt bleibt. Zudem fehlt Lehrkräften oft das grundlegende Wissen über Hochbegabung und Underachievement. Schnell fällt der Verdacht auf andere psychische Störungen, deren Symptome einer Hochbegabung sehr ähnlich sein können.

Bist du auf der Suche nach zuverlässigen Rechtstexten für deine Webpräsenzen?
Sei immer Up to Date bist du mit dem Update-Service der IT-Recht-Kanzlei. Erfahrungsgemäß ändern sich ca. 2x im Jahr rechtliche Daten. Ich empfehle die Kanzlei seit 2021 meinen Werbeagentur-Kunden - inkl. anwaltlicher Haftung.
Jetzt rechtlich absichern.(Werbung aufgrund persönlicher Erfahrungen)
Was Schule tun kann, um hochbegabten Kindern zu begegnen
Aber auch die Struktur des Bildungssystems birgt große Gefahren. Auch wenn hochbegabte Kinder sich in unterschiedlichen Schulsystemen wohlfühlen können, so bleibt da noch der kleine Teil der Schülerinnen und Schüler, die in ein Underachievement rutschen. Ihre Anstrengungsbereitschaft sinkt und der Frust steigt.
Ich hoffe, dass dir mein Einblick, wie diese Studien belegen, dass Hochbegabung zu Schulproblemen führen kann gefallen hat. Die Frage bleibt, was kann Schule tun, um diesem entgegenzuwirken? Hier ein paar Ansätze:
- Eine frühe Vermittlung von Lernstrategien besonders für Kinder, denen alles zufällt
- Die Berücksichtigung der besonderen Eigenschaften und Herausforderungen von Hochbegabung
- Die Sensibilisierung zum Thema Underachievement
- Eine Selbstreflexion und Überprüfung der eigenen Glaubenssätze
- Stärkung des Selbstwertgefühls von Hochbegabten im Sinne eines Growth Mindsets

Weiterbildung für Lehrkräfte - Workshops in Schulen mit Susanne Burzel:
Underachievement bei Hochbegabung erkennen und wirksam begegnen
Wie erkennst du Underachievement rechtzeitig? Welche Ursachen stecken dahinter? Und vor allem: Was kannst du als Lehrkraft konkret tun, um betroffene Schülerinnen und Schüler zu fördern und zu begleiten?
Das Angebot ist akkreditiert in der Lehrkräfte-Akademie Hessen.





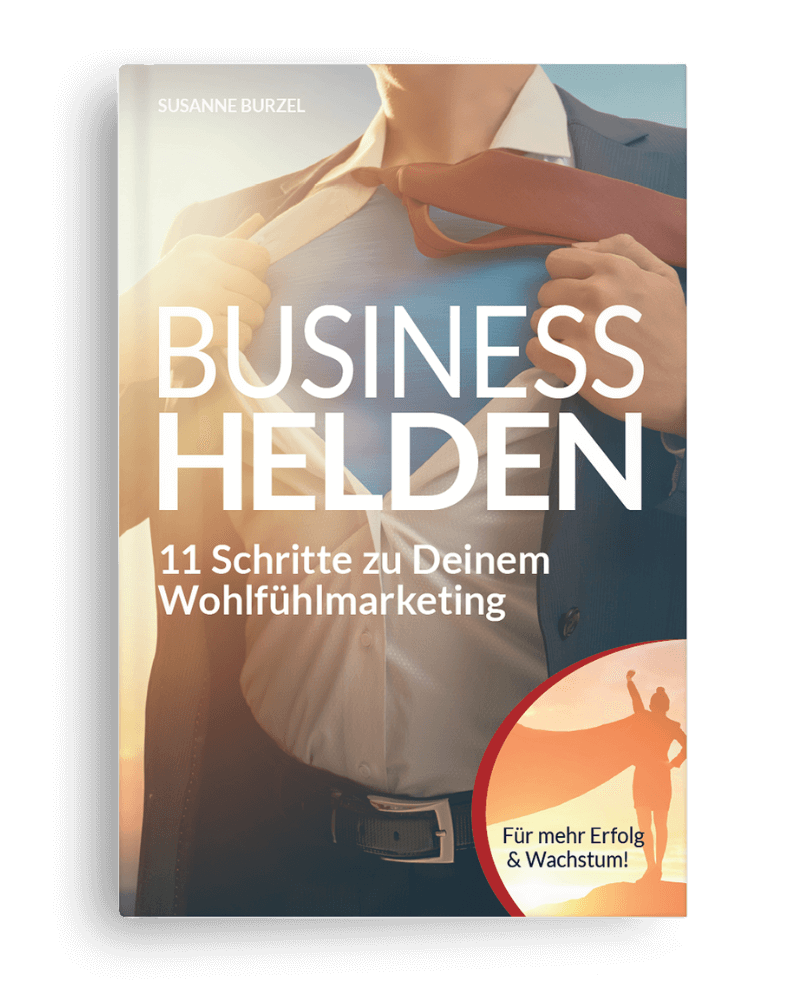


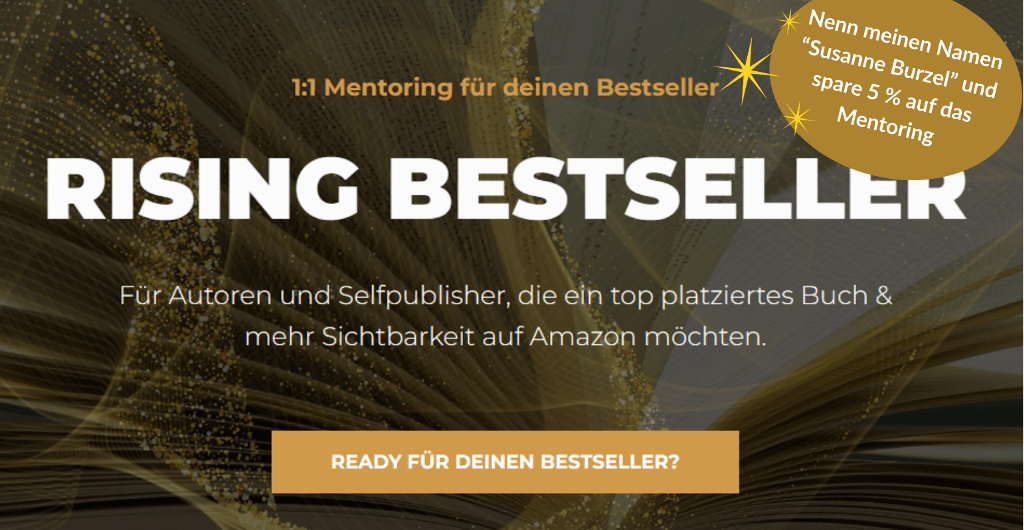



Wie könnte ich an die Studien kommen , um sie als pdf auszudrucken. Wir hätten gerne schriftliche „Beweise“ , weil wir gerade in die Not kommen, dass unser Sohn durch die Ängste nicht mehr zur Schule gehen kann. Und haben Angst vor Maßnahmen wie schulbegleitung durch Jugendamt usw…
Hallo,
zu den Studien habe ich immer die Quellen als Link angegeben. Dort am besten draufklicken und dort ausdrucken oder tiefer recherchieren 🙂
Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg!
Susanne